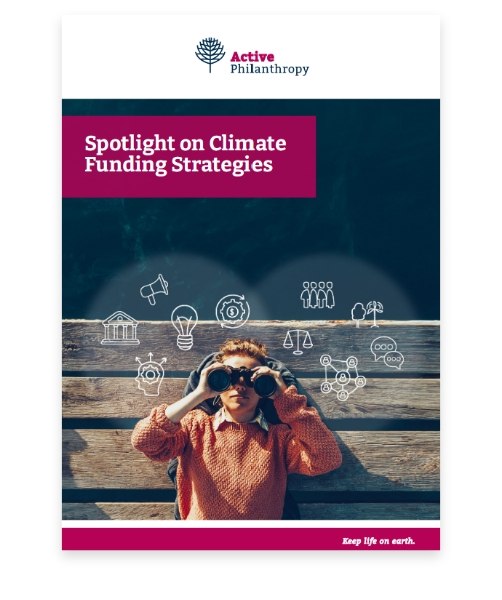Klimaförderstrategien im Blickpunkt
Mit unserer Veröffentlichung Klimaförderstrategien im Blickpunkt stellen wir zehn verschiedene Ansätze der Klimaphilanthropie vor.
Tipps zur Nutzung der Website
Wenn Sie auf ein Icon in der untenstehenden interaktiven Grafik klicken, gelangen Sie zu einer kurzen Einführung sowie zu Fallstudien, die die jeweilige Förderstrategie illustrieren. Wenn Sie direkt zu den Fallstudien springen möchten, klicken Sie auf die Kacheln am unteren Rand dieser Seite.
Einführung
Warum effektive Strategien wichtig sind
In der Stiftungswelt herrscht größtenteils Einigkeit darüber, dass der Klimawandel ein dringendes Problem darstellt. Allerdings haben sich viele bislang nicht in diesem Themenfeld engagiert, weil sie schlichtweg nicht wissen, wo sie anfangen sollen. Hinzu kommt: Nur wenige führende Vertreter:innen von Stiftungen sind davon überzeugt, dass die von ihnen angewendeten Strategien zur Bekämpfung des Klimawandels wirksam sind (Orensten et al. 2022). Diese Kluft zwischen dem Bewusstsein für die Klimakrise und der selbst attestierten Unwirksamkeit von Förderstrategien erfordert neue Ansätze. Es bestehen viele Möglichkeiten für Geber:innen, neue Strategien auszuprobieren, mit denen sie noch nicht vertraut sind bzw. die für die Region und das spezifische Klimaproblem, an dem sie arbeiten, neu sind.
Wenn Sie einen einfachen Zugang zur Klimaphilanthropie suchen oder verstehen möchten, welche Ansätze andere Klimaförder:innen verfolgen, erfahren Sie hier mehr darüber. Auf den nächsten Seiten finden Sie praktische Einblicke in die Arbeit von 15 europäischen und sieben US-amerikanischen Geber:innen. Sie regen dazu an, die eigene Förderstrategie zu überdenken und neue Partnerschaften ins Visier zu nehmen.
Influencing
Empowering
Innovating
Fallstudien
Influencing
Empowering
Innovating
PDF Download
Dieser Inhalt ist nur in englischer Sprache verfügbar.
Über das Spotlight
Das Spotlight in 2 Minuten erklärt – dieser Inhalt ist nur in englischer Sprache verfügbar.
Wenn Sie hier klicken, wird ein auf YouTube gehostetes Video abgespielt, bei dem Daten zwischen Ihnen und YouTube ausgetauscht werden. Weitere Informationen finden Sie in der Datenschutzrichtlinie von YouTube.
Unsere Partner:innen



Publikationsbibliographie
Alle Referenzen
Bainum Family Foundation (2020): Creating Change Through Policy Advocacy. 10 Ways Foundations Can Engage.
Bethesda, MD (Bainum Briefs, 2). Available online at https://bainumfdn.org/wp-content/uploads/2020/09/Bainum-
Brief_Volume-2_September-2020_Print.pdf, checked on 8/5/2022
Baykara, Hilal (2016): Funding the Frontlines: The Value of Supporting Grassroots Organizing. Edited by Philanthropy
News Digest. Candid. Available online at https://philanthropynewsdigest.org/features/commentary-and-opinion/
funding-the-frontlines-the-value-of-supporting-grassroots-organizing, checked on 8/31/2022.
Braemer, Christian (2015): Philanthropy: The New Risk Capital? In Stanford Social Innovation Review. Available online
at https://ssir.org/articles/entry/philanthropy_the_new_risk_capital#, checked on 8/11/2022.
Braverman, Beth (2018): The Nathan Cummings Foundation’s Role as a Shareholder Activist. impactivate. Available
online at https://www.theimpactivate.com/the-nathan-cummings-foundations-role-as-shareholder-activist/,
checked on 8/11/2022.
Clifford Chance (2021): ESG Trends. The Rise of Climate Litigation and the Challenges for Businesses. Available online
at https://www.cliffordchance.com/content/dam/cliffordchance/briefings/2021/07/esg-trends-the-rise-of-climate-
litigation-and-the-challenges-for-business.pdf, checked on 8/16/2022.
Climate-ADAPT (2019): Capacity building on climate change adaptation. Available online at https://climate-adapt.
eea.europa.eu/en/metadata/adaptation-options/capacity-building-on-climate-change-adaptation, checked on
11/9/2022.
Council on Foundations (2008): Solutions Brief. Strategic Communications. Available online at https://cof.org/sites/
default/files/documents/files/Strategic%20Communications%20Solutions%20Brief.pdf.
Cox, Suzanne; Hellstern, Tom; Henderson, Kimberley; Nowski, Tracy; O’Flanagan, Maisie; Pinner, Dickon et al. (2021):
It’s time for philanthropy to step up the fight against climate change. McKinsey. Available online at https://www.
mckinsey.com/business-functions/sustainability/our-insights/its-time-for-philanthropy-to-step-up-the-fight-against-
climate-change, checked on 8/9/2022.
Ditkoff, Susan Wolf; Grindle, Abe (2017): Audacious Philanthropy. Edited by Harvard Business Review. Harvard
Business Review. Available online at https://hbr.org/2017/09/audacious-philanthropy, checked on 11/17/2021.
Elliott, Matthew; Berger, Michael; Bidad, Helia (2019): Soil to Sky: Climate Solutions that Work. California
Environmental Associates. Available online at https://climasolutions.org/wp-content/uploads/2019/09/Soil-to-Sky-1.
pdf, checked on 11/18/2022.
Eurostat (2021): EU tax and social contribution revenue decreased in 2020. European Commission. Available online at
https://ec.europa.eu/eurostat/de/web/products-eurostat-news/-/ddn-20211029-2.
Food and Agriculture Organization of the United Nations; FILAC (2021): Forest governance by indigenous and tribal
peoples. An opportunity for climate action in Latin America and the Caribbean. FAO. Santiago. Available online at
https://www.fao.org/3/cb2953en/cb2953en.pdf, checked on 8/16/2022.
Gavalda, Manon; Dupont, Capucine; Brodin, Claire (2021): Philanthropy and development. Stocktake and partnership
strategy. Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères. Available online at https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/
pdf/rapport_drm_philanthropy_eng_web_cle0ab7b4.pdf, checked on 8/15/2022.
Goldsmith, Shane Murphy (2021): A Lesson From COVID: Direct Relief and Systems Change Funding Are Inseparable.
Edited by Inside Philanthropy. Available online at https://www.insidephilanthropy.com/home/2021/3/17/a-lesson-
from-covid-direct-relief-and-systems-change-funding-are-inseparable, checked on 8/5/2022.
Impact Investing Institute (2022): Butler-Sloss v Charity Commission marks a decisive step forward for investing
with impact in charitable foundations’ endowments. Available online at https://www.impactinvest.org.uk/butler-
sloss-v-charity-commission-marks-a-decisive-step-forward-for-investing-with-impact-in-charitable-foundations-
endowments/, checked on 9/7/2022.
Lorentz, Bernhard; Meier, Johannes (2012): Strategische Philanthropie zum Klimaschutz. Ansätze am Beispiel
der Stiftung Mercator und der European Climate Foundation. Edited by Stiftung & Sponsoring – Das Magazin für
Nonprofit-Management und -Marketing. Berlin, Essen (Rote Seiten). Available online at https://www.stiftung-
mercator.de/content/uploads/2020/12/Strategische_Philanthropie_Klimaschutz.pdf.
Morris, Brandi S.; Chrysochou, Polymeros; Christensen, Jacob Dalgaard; Orquin, Jacob L.; Barraza, Jorge; Mitkidis,
Panagiotis (2019): Stories vs. facts: triggering emotion and action-taking on climate change. In Climatic Change 154
(1), pp. 19–36. Available online at https://link.springer.com/article/10.1007/s10584-019-02425-6, checked on 8/9/2022.
Müller, Markus; Börger, Enrico; Bovenzi, Michele (2018): CIO Insights Reflections. Positiven Einfluss ausüben – auf
Rendite und Gesellschaft. ESG bewerten. Deutsche Bank Wealth Management. Available online at https://
deutschewealth.com/content/dam/deutschewealth/cio-as-sets/esg/CIO%20Insights%20Reflections%20ESG%20
Positiven%20Einfluss%20aus%c3%bcben%20WM%20German%20client%20ready.pdf, checked on 11/14/2022.
Nature (2022): How researchers can help fight climate change in 2022 and beyond. In Nature 601 (7891), p. 7. DOI:
10.1038/d41586-021-03817-4.
Ng, Alice (2021): Why Big Philanthropy Falls Short at Supporting the Grassroots—and How it Can Do Better. Inside
Philanthropy. Available online at https://www.insidephilanthropy.com/home/2021/8/31/why-big-philanthropy-falls-
short-at-supporting-the-grassrootsand-how-it-can-do-better, checked on 8/5/2022.
Orensten, Naomi; Malmgren, Katarina; Lopez, Maria (2022): Much Alarm, Less Action. Foundations & Climate
Change. The Center for Effective Philanthropy. Cambridge, MA. Available online at http://cep.org/wp-content/
uploads/2022/07/CEP_Much_Alarm_Less_Action.pdf, checked on 8/8/2022.
Ozden, James (2022): Protest Movements Could Be More Effective Than the Best Charities. Stanford Social Innovation
Review. Available online at https://ssir.org/articles/entry/protest_movements_could_be_more_effective_than_the_
best_charities, checked on 11/18/2022.
Padmanabhan, Chandrima; Rose, Katie (2021): Public Engagement on Climate Change. A Case Study Compendium.
Centre for Public Impact; Calouste Gulbenkian Foundation (UK Branch). Available online at https://www.
centreforpublicimpact.org/assets/documents/cpi-cgf-public-engagement-climate-change-case-studies.pdf, checked
on 8/9/2022.
Philea (2021): Data on the sector. Available online at https://philea.eu/how-we-can-help/knowledge/data-on-the-
sector/, checked on 8/23/2022.
Putnam-Walkerly, Kris (2010): 15 Ways to Improve Grantee Communication at Your Foundation. Available online at
https://putnam-consulting.com/practical-tips-for-philanthropists/philanthropy/improve-grantee-communication/,
checked on 8/3/2022.
Roeyer, Hannah; Desanlis, Helene; Cracknell, Jon (2021): Foundation funding for climate change mitigation. Europe
Spotlight. Climateworks; EFC; The Hour Is Late. Available online at https://www.climateworks.org/wp-content/
uploads/2021/10/CWF_Funding_Trends_Report_Europe_2021.pdf, checked on 10/13/2021.
Schiermeier, Quirin (2021): Climate science is supporting lawsuits that could help save the world. News Feature. In
Nature. Available online at https://www.nature.com/articles/d41586-021-02424-7, checked on 8/16/2022.
ShareAction (2022): Shareholder Activism. ShareAction. Available online at https://shareaction.org/unlocking-the-
power/shareholder-resolutions, checked on 8/11/2022.
Sobrevila, Claudia (2008): The Role of Indigenous Peoples in Biodiversity Conservation. The Natural but Often
Forgotten Partners. The World Bank. Washington, D.C. Available online at https://documents1.worldbank.org/
curated/en/995271468177530126/pdf/443000WP0BOX321onservation01PUBLIC1.pdf, checked on 8/12/2022
Teulings, Jasper; Pradhan, Shishusri (2021): Assessing the impact of climate litigation. Edited by Alliance Magazine.
CIFF. Available online at https://www.alliancemagazine.org/blog/assessing-the-impact-of-climate-litigation/,
updated on 3/3/2021, checked on 8/16/2022
Treen, Kathie M. d’I.; Williams, Hywel T. P.; O’Neill, Saffron J. (2020): Online misinformation about climate change.
Available online at https://wires.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/wcc.665, checked on 8/3/2022.
Trewin, Blair; Morgan-Bulled, Damian; Cooper, Sonia (2021): Climate: National and international frameworks.
Australian Government Department of Agriculture, Water and the Environment. Canberra (Australia State of the
environment 2021). Available online at https://soe.dcceew.gov.au/climate/management/national-and-international-
frameworks.
UNEP; Sabin Center for Climate Change Law (2020): Global Climate Litigation Report. 2020 Status Review.
Nairobi, Kenya. Available online at https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/34818/GCLR.
pdf?sequence=1&isAllowed=y, checked on 8/16/2022.
Watson, Sara (2022): 16 Grantmaking Characteristics to Effectively Support Public Policy Advoca-cy. Edited by Bolder
Advocacy. Available online at https://bolderadvocacy.org/resource/16-grantmaking-characteristics-to-effectively-
support-public-policy-advocacy/, checked on 8/5/2022.
White & Case LLP (2018): Climate change litigation. A new class of action. London. Available online at https://www.
actu-environnement.com/media/pdf/news-33084-leadership.pdf, checked on 8/16/2022.
Wildlife Conservation Society (2021): Strategic Communications. Amplifying Succesful Conservation. Wildlife
Conservation Society. Available online at https://www.wcsclimateadaptationfund.org/strategic-communications,
checked on 8/11/2022.



Kontakt
Bitte richten Sie Ihre Anfragen, Kommentare, Rückmeldungen oder Fragen bezüglich des Leitfadens an Dr. Johannes Lundershausen und/oder Louis Wilß.